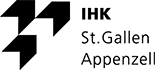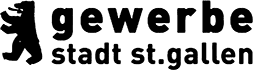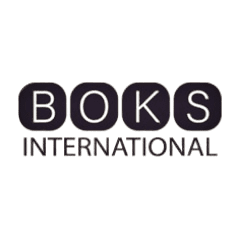Die Diskussion um die Einführung der Individualbesteuerung in der Schweiz hat in den letzten Monaten stark an Fahrt aufgenommen. Bislang werden Ehepaare gemeinsam veranlagt, was im progressiven Steuersystem teils zu Vorteilen, teils aber auch zu Nachteilen führen kann. Besonders Doppelverdiener-Ehepaare mit ähnlichem Einkommen sind durch die sogenannte «Heiratsstrafe» steuerlich benachteiligt, während traditionelle Einverdienerfamilien vom Splitting-Modell profitieren. Die Individualbesteuerung würde diese Unterschiede beseitigen: Jeder Erwachsene würde künftig sein Einkommen und Vermögen unabhängig vom Zivilstand selbständig deklarieren und versteuern. Damit wäre die steuerliche Belastung vollständig zivilstandsneutral.
Politisch ist die Entwicklung weit fortgeschritten. Nach mehreren gescheiterten Reformversuchen lancierten die FDP Frauen 2022 die Volksinitiative «Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung». Der Bundesrat legte daraufhin einen indirekten Gegenvorschlag in Form eines Bundesgesetzes vor, das im Juni 2025 vom Parlament verabschiedet wurde, wenn auch mit äusserst knappen Mehrheiten. Parallel dazu reichte Die Mitte eine eigene Initiative ein, die an der gemeinsamen Besteuerung festhalten, aber die Heiratsstrafe durch eine alternative Berechnung beseitigen will. Gegen den parlamentarischen Entscheid zur Individualbesteuerung formierte sich inzwischen ein überparteiliches Referendumskomitee, sodass das Schweizer Stimmvolk voraussichtlich 2026 das letzte Wort haben wird.
Die geplante Reform bringt einen tiefgreifenden Systemwechsel mit sich. Künftig sollen Ehegatten strikt separat veranlagt werden, wobei zur Entlastung von Familien der Kinderabzug bei der direkten Bundessteuer von 6’700 CHF auf 12’000 CHF pro Kind erhöht wird. Zudem sind Anpassungen der Steuertarife vorgesehen, die insbesondere tiefe und mittlere Einkommen entlasten sollen, während sehr hohe Einkommen eine leicht höhere Belastung erfahren. Damit verbunden sind Mindereinnahmen für Bund und Kantone in der Grössenordnung von jährlich rund CHF 600 Millionen. Hinzu kommt ein erheblicher administrativer Mehraufwand: Ehepaare müssten künftig je eine eigene Steuererklärung einreichen, was schweizweit über 1,5 Millionen zusätzliche Veranlagungen pro Jahr bedeutet. Deswegen erwägen einige Kantone das Kantonsreferendum.
Die Auswirkungen auf die Steuerpflichtigen sind unterschiedlich. Verheiratete Doppelverdienerpaare gehören klar zu den Gewinnern, da die Heiratsstrafe entfällt. Auch viele Rentner-Ehepaare und Alleinstehende profitieren von den neuen Tarifen. Demgegenüber würden klassische Einverdienerfamilien steuerlich stärker belastet, da der Splitting-Vorteil wegfällt und ungenutzte Kinderabzüge nicht übertragbar sind. Für unverheiratete Paare ändert sich wenig, sie werden schon heute individuell besteuert, allerdings entfällt ihr bisheriger Vorteil gegenüber Ehepaaren. Alleinerziehende dürften in den meisten Fällen von der Erhöhung des Kinderabzugs profitieren.
Die Befürworter der Reform argumentieren mit mehr Steuergerechtigkeit, der Beseitigung einer seit Jahrzehnten als verfassungswidrig erkannten Heiratsstrafe und positiven Effekten auf die Erwerbstätigkeit, insbesondere von Frauen. Gegner hingegen warnen vor einem Bürokratiemonster, erheblichen Umstellungskosten und neuen Ungerechtigkeiten zulasten traditioneller Familienmodelle. Für die Praxis bedeutet dies: Bis zu einer Volksabstimmung bleibt alles beim Alten. Sollte die Bevölkerung der Vorlage zustimmen, stünde der Schweiz die wohl grösste Steuerreform der letzten Jahrzehnte bevor, mit erheblichen Konsequenzen für Ehepaare, Familien und die Steuerbehörden.

Senior Partner
kummer@stach.ch
+41 (0)71 278 78 28