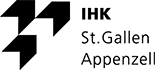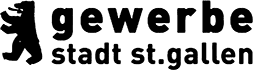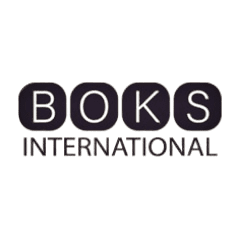Das Unterhaltsrecht ist einer der zentralen Themen bei Trennung und Scheidung. Es regelt die finanziellen Folgen zwischen den Ehegatten und gegenüber den gemeinsamen Kindern während der Trennung und nach erfolgter Scheidung. Dabei wird zwischen Kindesunterhalt und Ehegattenunterhalt unterschieden. Während der Kindesunterhalt auf der lebenslangen Verantwortung der Eltern beruht, ist der Ehegattenunterhalt stark vom Prinzip der Eigenverantwortung und der Frage der lebensprägenden Ehe geprägt.
Kindesunterhalt: Vorrang und Betreuungsunterhalt
Seit der Revision 2017 sind Kinder von verheirateten und unverheirateten Eltern gleichgestellt. Der Kindesunterhalt hat Vorrang vor allen anderen familienrechtlichen Ansprüchen. Er umfasst den Barunterhalt, also das, was für ein Kind an Kosten für Wohnung, Nahrung, Kleidung, Ausbildung, medizinische Versorgung, etc. effektiv anfällt, und den Betreuungsunterhalt, der die Betreuung durch einen Elternteil finanziell berücksichtigt, also den Lohnausfall entschädigt, der ein Elternteil allenfalls hat, weil er weniger arbeitet, um die Kinder betreuen zu können.
Die Berechnung erfolgt nach dem Bedarfsprinzip: Zunächst wird der Grundbedarf aller Familienmitglieder sichergestellt, danach wird ein allfälliger Überschuss unter allen verteilt. Können die Eltern mit ihren Einkommen den vollen Bedarf nicht decken, hält das Gericht den Fehlbetrag im Urteil fest. Die Unterhaltspflicht dauert grundsätzlich bis zur Volljährigkeit und darüber hinaus bis zum Abschluss einer ersten angemessenen Ausbildung.
Ehegattenunterhalt: Trennung und Scheidung
Während der Trennung können im Eheschutzverfahren Unterhaltsbeiträge zugesprochen werden. Sie richten sich nach den wirtschaftlichen Verhältnissen, der Aufgabenteilung und dem während der Ehe gelebten Lebensstandard.
Für die Zeit nach der der Scheidung steht die Eigenverantwortung im Vordergrund. Das heisst, grundsätzlich sollen die Ehegatten nach der Scheidung jeder für sich selbst ein Einkommen erzielen und damit den eigenen Lebensunterhalt bestreiten. Verzichtet ein Ehegatte auf eine Arbeitstätigkeit oder geht einer solchen nur teilweise nach, kann ihm ein hypothetisches Einkommen angerechnet werden. Ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt besteht nur, wenn der berechtigte Ehegatte seinen gebührenden Unterhalt nicht selbst bestreiten kann. Entscheidend ist, ob die Ehe als lebensprägend gilt – also den Lebenslauf eines Ehegatten nachhaltig geprägt hat, etwa durch jahrelange Kinderbetreuung und Aufgabe der Erwerbstätigkeit.
Das Bundesgericht hat die Anforderungen zuletzt verschärft: Gemeinsame Kinder allein begründen keinen Anspruch mehr. Nachteile aus der Kinderbetreuung sollen primär über den Kindesunterhalt abgegolten werden. Ehegattenunterhalt wird zunehmend zeitlich befristet oder abgestuft, um die Rückkehr in die Eigenversorgung zu fördern.
Durchsetzung und Anpassung
Bleiben Unterhaltszahlungen aus, stehen Betreibung, Lohnpfändung und die Unterstützung durch Alimenteninkassostellen zur Verfügung. Für Kinder existiert zudem die Möglichkeit der Alimentenbevorschussung durch den Staat. In gravierenden Fällen kann auch eine Strafanzeige wegen Verletzung der Unterhaltspflicht erhoben werden.
Unterhaltsregelungen können angepasst werden, wenn sich die Verhältnisse wesentlich und dauerhaft ändern. Selbstverschuldete Verschlechterungen, etwa durch freiwillige Reduktion des Arbeitspensums, werden dabei nicht berücksichtigt – die Gerichte rechnen ein hypothetisches Einkommen an.
Fazit
Das Unterhaltsrecht bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Kindeswohl, ehelicher Solidarität und Eigenverantwortung. Kinder geniessen stets Vorrang. Ehegattenunterhalt bleibt möglich, ist aber in der heutigen Praxis stark eingeschränkt und an strenge Voraussetzungen geknüpft. Für Betroffene ist es ratsam, frühzeitig rechtliche Beratung einzuholen, um Ansprüche zu sichern oder unberechtigte Forderungen abzuwehren.

Senior Partner
kummer@stach.ch
+41 (0)71 278 78 28